Willkommen zu unserem VR & AR-Kurs!

1. Einführung und erste Grundlagen
Virtual Reality (VR) hat sich in den letzten Jahren als vielversprechende Technologie etabliert, die auch in der Lehre neue Perspektiven eröffnet.
In diesem Kurs widmen wir uns den Grundlagen, Einsatzmöglichkeiten und Potenzialen von VR und AR im Bildungsbereich. Dabei beleuchten wir nicht nur die Chancen, sondern auch die Herausforderungen und Grenzen, die mit der Integration von immersiven Technologien in die Lehre verbunden sind.
Im Gegensatz zu verwandten Technologien wie Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR) zeichnet sich Virtual Reality durch eine vollständige Immersion (Vollständiges Eintauchen) aus: Nutzer*innen tauchen in eine computergenerierte, interaktive 3D-Umgebung ein, die ihre physische Realität vollständig ersetzt. Bei AR hingegen wird die reale Umgebung durch digitale Elemente ergänzt, sodass die physische Welt weiterhin sichtbar bleibt. MR kombiniert beide Ansätze, indem reale und virtuelle Elemente nahtlos miteinander verschmelzen und miteinander interagieren.
Ziel des Kurses ist es auch, Ihnen praxisnahe Einblicke in die Möglichkeiten von VR in der Lehre zu geben und Ihnen das nötige Wissen zu vermitteln, um immersive Lehr- und Lernszenarien erfolgreich zu gestalten und diese gezielter zu nutzen.
Merke: Abgrenzung von Virtual Reality zu anderen immersiven Technologien:

Virtual Reality (VR): In VR werden Nutzerinnen und Nutzer komplett in eine computergenerierte 3D-Umgebung versetzt. Die reale Welt wird dabei vollständig ausgeblendet, und alle Sinneseindrücke (visuell, auditiv und teilweise haptisch) stammen aus der virtuellen Umgebung. So entsteht das Gefühl, vollständig in eine andere Realität eingetaucht zu sein.
Augmented Reality (AR): AR erweitert die reale Welt um digitale Inhalte. Diese digitalen Elemente – etwa Texte, 3D-Modelle oder Animationen – werden über ein Gerät (zum Beispiel Smartphone oder AR-Brille) in die reale Umgebung eingeblendet, die dabei immer sichtbar bleibt.
Mixed Reality (MR): MR kombiniert VR- und AR-Elemente. Dabei werden reale und virtuelle Objekte so miteinander verknüpft, dass sie interagieren. Nutzerinnen und Nutzer erleben die reale Welt, angereichert mit digitalen Inhalten, die sich dynamisch in die physische Umgebung einfügen.
360°-Videos und -Bilder: Diese bieten eine „Rundumsicht“ auf eine aufgezeichnete oder gerenderte Szene, sind aber nicht interaktiv. Nutzerinnen und Nutzer können sich umsehen, aber nicht aktiv in die Szene eingreifen oder mit Objekten interagieren.
VR ist also die immersive Technologie, die Nutzerinnen und Nutzer vollständig aus der realen Welt herausnimmt, während AR und MR auf der realen Welt aufbauen und digitale Inhalte darüberlegen oder damit verschmelzen.
2. Historischer Überblick
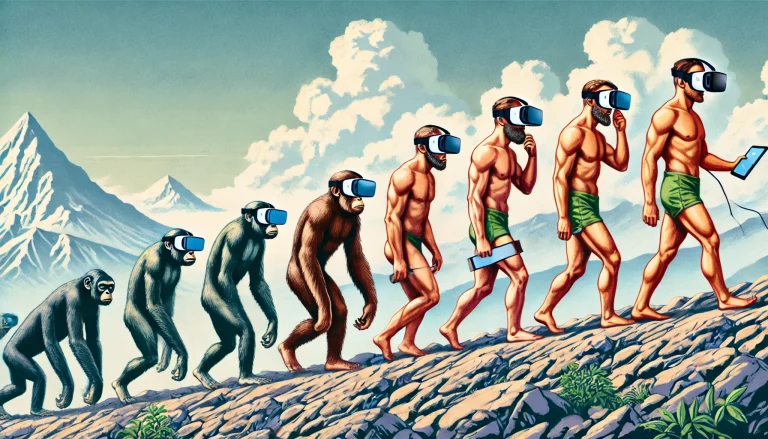
Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind Technologien, die unsere Wahrnehmung der Realität grundlegend verändern. Obwohl sie heute als „moderne Technologien“ gelten, reichen ihre Ursprünge viele Jahrzehnte zurück. Beide Konzepte haben sich über die Jahre hinweg kontinuierlich entwickelt und sind heute fester Bestandteil verschiedenster Anwendungsbereiche, von der Unterhaltung über Bildung bis zur Medizin.
Die Anfänge der Virtual Reality:
Die ersten Ansätze für Virtual Reality lassen sich bereits in den 1950er-Jahren finden. Morton Heilig entwickelte 1962 mit dem “Sensorama” ein multisensorisches Kinoerlebnis, das bereits eine immersive Wirkung erzielen sollte: mit 3D-Bildern, Stereoton, Gerüchen und vibrierenden Sitzen. Dieser Vorläufer kann als Grundstein für spätere VR-Erfahrungen angesehen werden.
Einen großen Meilenstein markierte 1968 die Entwicklung des ersten Head-Mounted Displays (HMD) durch Ivan Sutherland. Das “Sword of Damocles” genannte Gerät konnte computergenerierte Bilder anzeigen, die sich mit der Kopfbewegung mitbewegten – ein Prinzip, das noch heute in modernen VR-Headsets zum Einsatz kommt.
In den 1980er- und 1990er-Jahren rückte Virtual Reality stärker in den Fokus von Forschung und Industrie. Jaron Lanier, Gründer von VPL Research, prägte den Begriff “Virtual Reality” und entwickelte erste kommerzielle VR-Geräte wie Datenhandschuhe und HMDs. Gleichzeitig erschienen erste VR-Arcade-Spiele, etwa “Virtuality” von W Industries, die jedoch aufgrund technischer Limitierungen noch nicht den Massenmarkt erobern konnten.
Damals waren VR-Anwendungen vor allem in der Forschung und im Militär im Einsatz, doch erste Bildungsexperimente gab es ebenfalls: So wurden etwa in Medizinerausbildungen 3D-Anatomie-Modelle getestet, um komplexe Zusammenhänge zu visualisieren.
Aufstieg und Durchbruch der Virtual Reality
Ab den 2000er-Jahren ermöglichten Fortschritte in Computergrafik und Sensorik bessere VR-Erlebnisse. Ein entscheidender Wendepunkt kam 2012, als Palmer Luckey die Oculus Rift vorstellte, ein leichtes und vergleichsweise günstiges VR-Headset mit präzisem Tracking. Große Unternehmen wie Facebook (heute Meta), Sony und HTC erkannten das Potenzial und entwickelten eigene VR-Brillen, die heute in vielen Haushalten und Bildungseinrichtungen genutzt werden.
VR wird mittlerweile in vielfältigen Bereichen eingesetzt: von der Architektur und dem Design über die Medizin bis hin zur Kunst und Bildung.
Ab den 2000er-Jahren ermöglichte bessere Computertechnik realistischere und interaktivere VR-Umgebungen. Mit der Oculus Rift (2012) wurde VR für viele erschwinglich und in kurzer Zeit zu einem wichtigen Werkzeug für die Bildung. Heute gibt es eine Vielzahl von Lern-Apps und -Simulationen in VR. Typische Beispiele sind u.a., dass Studierende der Medizin VR nutzen, um Operationen virtuell zu üben oder Naturwissenschaftler*innen in virtuellen Laboren Experimente risikolos durchführen können.
Die Entwicklung von Augmented Reality
Während Virtual Reality auf vollständige Immersion in eine virtuelle Umgebung setzt, verbindet Augmented Reality die reale Welt mit digitalen Inhalten. Erste Versuche, reale Bilder mit digitalen Informationen zu überlagern, gehen ebenfalls auf Ivan Sutherland zurück. Allerdings wurde der Begriff „Augmented Reality“ erst 1990 von Tom Caudell geprägt, als er für Boeing eine Technologie entwickelte, um Montageanleitungen direkt ins Sichtfeld der Arbeiter einzublenden.
In den 2000er-Jahren kam AR mit mobilen Geräten verstärkt in den Alltag. Anwendungen wie AR-Visitenkarten, interaktive Werbekampagnen und einfache AR-Spiele zeigten, wie reale Bilder mit digitalen Elementen angereichert werden können.
Einen enormen Popularitätsschub erlebte AR 2016 mit dem Spiel Pokémon GO, das Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dazu brachte, digitale Kreaturen in ihrer physischen Umgebung zu suchen und zu fangen.
Parallel dazu entwickelten große Tech-Unternehmen spezialisierte AR-Brillen und -Plattformen. Microsoft brachte 2016 mit der HoloLens eine Mixed-Reality-Brille auf den Markt, die digitale Inhalte in die reale Welt projiziert und damit neue Möglichkeiten für Industrie, Bildung und Medizin eröffnet. Apple und Google entwickelten mit ARKit und ARCore leistungsfähige Entwicklungsumgebungen für mobile AR-Apps.
Große Technologieunternehmen wie Microsoft mit der HoloLens (2016) haben AR für Unterrichtszwecke nutzbar gemacht: Lehrkräfte können 3D-Modelle von Molekülen oder Maschinen direkt in den Klassenraum projizieren. Mit den AR-Entwicklungsumgebungen ARKit (Apple) und ARCore (Google) entstanden zahlreiche Bildungs-Apps, die reale Umgebungen mit digitalen Lerninhalten verknüpfen.
Zusammenfassung: VR und AR – Zwei Technologien mit gemeinsamen Wurzeln
Virtual Reality und Augmented Reality teilen gemeinsame Wurzeln, unterscheiden sich jedoch grundlegend in ihrem Ansatz. Während VR vollständige Immersion bietet und die reale Welt vollständig ausblendet, erweitert AR die physische Welt um digitale Inhalte. Beide Technologien haben sich seit den ersten Prototypen in den 1960er-Jahren rasant entwickelt und sind heute in vielen Bereichen unverzichtbar. Der kontinuierliche Fortschritt in Hard- und Software macht VR und AR zu wichtigen Werkzeugen, um neue Formen des Lernens, der Zusammenarbeit und der Unterhaltung zu gestalten. VR und AR haben sich von experimentellen Ansätzen der 1960er-Jahre zu wichtigen Bildungswerkzeugen entwickelt. VR schafft immersive Lernumgebungen, in denen Lernende vollständig in virtuelle Welten eintauchen und komplexe Inhalte „erleben“ können. AR ergänzt die reale Welt um digitale Informationen und hilft so, abstrakte Lerninhalte anschaulich zu machen – etwa durch 3D-Modelle im Biologieunterricht oder interaktive Karten in Geografie.
Beide Technologien bieten neue Wege, um Lernen anschaulicher, praxisnäher und motivierender zu gestalten. Mit der fortschreitenden Entwicklung von Hard- und Software werden VR und AR künftig noch stärker in der Lehre verankert sein – sei es im Schulunterricht, in Hochschulen oder in der beruflichen Weiterbildung.
Geschichte von Virtual Reality (VR)
1950er-1960er:
- Erste Experimente mit “Stereoskopie” (zwei Bilder für ein 3D-Erlebnis).
- 1962: Morton Heilig entwickelt das “Sensorama”, ein multisensorisches Kinoerlebnis mit 3D-Bildern, Ton und Gerüchen.
- 1968: Ivan Sutherland baut das erste Head-Mounted Display (HMD), bekannt als “The Sword of Damocles”.
1980er-1990er:
- Fortschritte in Computergrafik und -leistung.
- Erste kommerzielle VR-Systeme, zum Beispiel VPL Research von Jaron Lanier.
- VR-Arcade-Spiele erscheinen, zum Beispiel “Virtuality” von W Industries.
2000er-2010er:
- Fortschritte in Display-Technologien und Sensoren.
- 2012: Palmer Luckey stellt die Oculus Rift vor – eine Revolution in der VR-Welt.
- Große Unternehmen (Facebook, Sony, HTC) bringen VR-Headsets auf den Markt.
Bis heute
- VR wird in vielen Bereichen genutzt: Bildung, Medizin, Architektur, Kunst, Unterhaltung.
- Geräte wie Meta Quest, PlayStation VR oder HTC Vive sind weit verbreitet.
Geschichte von Augmented Reality (AR)
1960er-1970er:
- Ebenfalls Ivan Sutherland: sein HMD legte auch Informationen über reale Szenen (Frühform von AR).
1980er-1990er:
- Der Begriff “Augmented Reality“ wird geprägt (Tom Caudell, 1990).
- Erste Anwendungen in der Luftfahrt und im Militär.
2000er:
- Fortschritte in Computergrafik und Kamera-Technologien.
- Erste Handy-Apps mit AR-Elementen (zum Beispiel AR-Visitenkarten, Werbekampagnen).
2010er:
- Pokémon GO (2016) zeigt, wie AR den Massenmarkt erreichen kann.
- Apple und Google entwickeln AR-Toolkits (ARKit, ARCore).
- Headsets wie Microsoft HoloLens ermöglichen „hands-free AR“.
Bis heute:
- AR wird in Bildung, Wartung, Medizin, Kunst, Industrie eingesetzt.
- Immer stärkere Verknüpfung mit mobilen Geräten (Smartphones, Tablets).
Zusammenfassung:
VR: Volle Immersion in eine virtuelle Umgebung, erste Versuche ab 1960er Jahren, kommerzieller Durchbruch ab 2010er Jahre.
AR: Überlagerung digitaler Inhalte auf die reale Welt, Begriff seit 1990, heute vor allem auf Smartphones/Tablets und in spezialisierten Brillen.
Beide Technologien: Ursprünglich militärische/industrielle Anwendungen, heute breite Nutzung in Bildung, Unterhaltung, Medizin und mehr.
Zukunft: Weiterentwicklung der Hardware (leichtere Brillen, bessere Displays) und softwareseitig immersive Lernumgebungen und produktive Anwendungen.
3. Chancen und Herausforderungen zu VR und AR

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind zwei Technologien, die in den letzten Jahren immer mehr Aufmerksamkeit erlangt haben. Beide eröffnen neue Möglichkeiten für Bildung, Unterhaltung, Medizin, Industrie und viele andere Bereiche. Gleichzeitig bringen sie jedoch auch Herausforderungen mit sich, die nicht außer Acht gelassen werden dürfen.
Chancen von VR und AR
Der größte Vorteil von VR liegt in der Möglichkeit, vollständig immersive Erlebnisse zu schaffen. Nutzerinnen tauchen in virtuelle Welten ein und können dort komplexe Szenarien erleben. In der Bildung eröffnet dies neue Wege, um theoretisches Wissen anschaulich und praxisnah zu vermitteln. So können Schülerinnen oder Studierende beispielsweise historische Stätten virtuell besuchen, gefährliche Experimente gefahrlos simulieren oder anatomische Modelle dreidimensional erkunden.
Auch AR bietet vielfältige Potenziale für das Lernen und Arbeiten. Statt die reale Welt auszublenden, ergänzt AR sie mit zusätzlichen Informationen. Im Unterricht können so etwa digitale 3D-Modelle direkt auf realen Objekten eingeblendet werden. In der beruflichen Weiterbildung unterstützen AR-Anwendungen Monteure bei Wartungsarbeiten, indem sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen ins Sichtfeld einblenden.
Darüber hinaus fördern VR und AR Kreativität und Motivation. Durch das interaktive und spielerische Erleben von Lerninhalten wird Neugier geweckt und der Zugang zu komplexen Themen erleichtert. In der Medizin unterstützen VR-Trainings zum Beispiel Chirurg*innen bei der Vorbereitung auf schwierige Eingriffe. In der Architektur und im Design ermöglichen VR und AR, Räume und Produkte bereits vor ihrer Entstehung erlebbar zu machen.
Herausforderungen von VR und AR
Trotz dieser Chancen gibt es auch bedeutende Herausforderungen. Eine der größten Hürden ist die technische Ausstattung. Hochwertige VR-Headsets oder AR-Brillen sind oft teuer, was ihre Verbreitung in Bildungseinrichtungen oder kleineren Unternehmen erschwert. Auch die Bedienung solcher Geräte erfordert Schulungen, damit sie sinnvoll und sicher eingesetzt werden können.
Hinzu kommen gesundheitliche Aspekte. Bei längerer Nutzung von VR können Probleme wie Schwindel, Übelkeit oder Kopfschmerzen auftreten, das sogenannte “Cyber Sickness”.
Bei AR besteht die Herausforderung, digitale Inhalte so in die reale Welt einzubinden, dass sie sinnvoll und nicht überfordernd wirken. So stellt sich die Frage, ob VR und Ar-Technologien schon in früheren Jahren eingesetzt werden sollen.
Ein weiterer Punkt ist die Gestaltung der Inhalte. Damit VR- und AR-Anwendungen ihr Potenzial ausschöpfen, müssen sie didaktisch durchdacht und zielgruppengerecht aufbereitet sein. Reine “Technikspielereien” ohne pädagogischen Mehrwert laufen Gefahr, Lernende eher abzulenken als zu unterstützen.
Schließlich werfen VR und AR auch ethische und datenschutzrechtliche Fragen auf. Da immersive Technologien viele Daten über Nutzerinnen und Nutzer (zum Beispiel Blickverhalten oder Bewegungsmuster) erfassen, müssen diese sensibel behandelt und vor Missbrauch geschützt werden.
Fazit:
Virtual Reality und Augmented Reality bieten faszinierende Möglichkeiten, Lern- und Arbeitswelten zu revolutionieren. VR ermöglicht vollständige Immersion, AR bereichert die reale Welt mit zusätzlichen Informationen.
Beide Technologien haben das Potenzial, Bildung praxisnaher, spannender und effektiver zu gestalten.
Gleichzeitig müssen die Herausforderungen ernst genommen werden. So sind die technische Ausstattung, Datenschutz und didaktische Qualität sind entscheidende Faktoren für den Erfolg dieser Technologien. Nur wenn VR und AR gezielt und verantwortungsvoll eingesetzt werden, können sie ihre Stärken wirklich entfalten und einen nachhaltigen Mehrwert schaffen.
4. Technologische Grundlagen

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) sind faszinierende Technologien, die unsere Wahrnehmung der Welt erweitern oder sogar vollständig ersetzen. Beide basieren auf einer Kombination aus leistungsfähiger Hardware und spezialisierter Software, die immersive Erlebnisse möglich machen. Dabei unterscheiden sich die grundlegenden Ansätze und Technologien, die VR und AR ermöglichen.
Hardware: Brillen und Sensoren
Im Zentrum von VR- und AR-Systemen stehen Head-Mounted Displays (HMDs), also Brillen, die direkt vor den Augen getragen werden.
VR-Headsets (zum Beispiel Meta Quest, PlayStation VR2) besitzen Bildschirme, die jeweils ein leicht versetztes Bild für jedes Auge darstellen.
Das sorgt für einen 3D-Eindruck (Stereoskopie) und ermöglicht das Gefühl, “mitten drin” zu sein.
AR-Brillen (zum Beispiel HoloLens 2, Magic Leap 2) haben transparente oder semitransparente Displays, die digitale Inhalte direkt ins Sichtfeld der Nutzerinnen und Nutzer projizieren.
Sensoren spielen eine entscheidende Rolle für die Immersion:
Gyroskope, Beschleunigungssensoren und Magnetometer erfassen Drehungen und Bewegungen des Kopfes.
Kameras und Tiefensensoren (zum Beispiel in AR-Headsets) ermöglichen das Scannen der Umgebung, sodass digitale Objekte perspektivisch korrekt eingefügt werden können.
Hand-Tracking-Module oder Controller erlauben es, mit der virtuellen oder erweiterten Welt zu interagieren.
Software: Echtzeit-Rendering und Interaktivität
Neben der Hardware ist die Software der Schlüssel für realistische VR- und AR-Erlebnisse.
Rendering-Engines (wie Unity oder Unreal Engine) erzeugen dreidimensionale Szenen in Echtzeit.
Tracking-Algorithmen berechnen kontinuierlich die Position und Bewegungen der Nutzerinnen und Nutzer und passen die Darstellung an, um eine möglichst “nahtlose” Erfahrung zu schaffen.
in AR kommen außerdem SLAM-Algorithmen (Simultaneous Localization and Mapping) zum Einsatz, die die reale Umgebung kartieren und digitale Inhalte präzise darin verankern.
3D-Modelle und Interaktion
Für VR- und AR-Inhalte sind detailreiche 3D-Modelle essenziell.
Sie werden mit CAD-Software oder 3D-Modellierungsprogrammen erstellt und in die Anwendung eingebunden. Damit Nutzerinnen und Nutzer mit der virtuellen oder erweiterten Welt interagieren können, werden zudem intuitive Bedienkonzepte entwickelt: von Controllern über Hand-Tracking bis zu Sprachsteuerung.
Unterschiede in der Umsetzung
Der grundlegende Unterschied liegt darin, wie stark die reale Welt sichtbar bleibt:
VR blendet die reale Welt aus und versetzt Nutzerinnen und Nutzer in eine komplett virtuelle Umgebung. AR legt digitale Inhalte über die reale Welt, sodass beide miteinander verschmelzen.
Fazit: Präzision und Rechenleistung als Schlüssel
Sowohl VR als auch AR sind hochgradig rechenintensive Technologien. Je präziser Sensoren, Tracking und Rendering arbeiten, desto überzeugender und “natürlicher” ist das Erlebnis. Fortschritte in Prozessorleistung, Grafiktechnologie und Miniaturisierung haben dazu geführt, dass immersive Technologien heute nicht nur in der Forschung und Industrie, sondern auch im Bildungsbereich, in Spielen und in der Kunst angekommen sind.
5. Geräteüberblick

Nun erfolgt ein kurzer Geräteüberblick über aktuelle VR- / AR-Geräte mit Ihren Vor- und Nachteilen (Stand 2025). Selbstverständlich geht die Entwicklung rasant weiter, so dass dies nur den augenblicklichen Entwicklungsstand wiedergibt.
Virtual-Reality-Geräte (VR):
1. Meta Quest 3 (ehemals Oculus Quest)
- Typ: Kabelloses VR-Headset (Standalone)
- Besonderheiten: Keine Verbindung zu PC nötig, Inside-Out-Tracking, gute Grafikleistung, handliches Design
- Einsatzbereiche: Gaming, Bildung, Fitness, Business
2. PlayStation VR2
- Typ: VR-Headset für die PlayStation 5
- Besonderheiten: 4K-OLED-Displays, Eye-Tracking, haptisches Feedback, beeindruckende Grafik
- Einsatzbereiche: Gaming und immersive Erlebnisse für Konsolenfans
3. HTC Vive XR Elite
- Typ: Modulares VR-Headset (Standalone + PC-VR)
- Besonderheiten: Leicht und komfortabel, modulare Erweiterungen (zum Beispiel für AR-Inhalte), hohe Flexibilität
- Einsatzbereiche: Bildung, Design, Simulationen
4. Pico 4
- Typ: Kabelloses Standalone-VR-Headset
- Besonderheiten: Leichtes Design, relativ günstiger Preis, gute Alternative zur Quest 3
- Einsatzbereiche: Unterhaltung, Fitness, Training
5. Varjo XR-4 / Aero
- Typ: High-End-VR-Headsets
- Besonderheiten: Sehr hohe Auflösung („menschliche Augen“-Qualität), für professionelle Anwendungen
- Einsatzbereiche: Industrie, Simulationen, Medizin
Augmented-Reality-Geräte (AR):
1. Microsoft HoloLens 2
- Typ: AR-Headset mit transparentem Visier
- Besonderheiten: Hand-Tracking, Sprachsteuerung, robuste Bauweise
- Einsatzbereiche: Industrie (zum Beispiel Wartung, Schulung), Medizin, Architektur
2. Magic Leap 2
- Typ: Leichtes AR-Headset
- Besonderheiten: Hoher Tragekomfort, präzises Tracking, gute Bildqualität
- Einsatzbereiche: Gesundheitswesen, Bildung, Forschung
3. Apple Vision Pro (AR/MR-Brille)
- Typ: Mixed-Reality-Headset mit AR-Fokus
- Besonderheiten: Hochauflösende Displays, Eye-Tracking, Integration ins Apple-Ökosystem
- Einsatzbereiche: Produktivität, Bildung, kreative Anwendungen
4. Lenovo ThinkReality A3
- Typ: AR-Brille für Business-Anwendungen
- Besonderheiten: Leicht, anschließbar an PCs oder Smartphones, für den Einsatz in Büroumgebungen
- Einsatzbereiche: Virtuelle Arbeitsumgebungen, Fernwartung
Zusammenfassung:
VR-Headsets sind oft komplett immersive Systeme, die besonders für Training, Spiele und Simulationen genutzt werden.
AR-Brillen ergänzen die reale Welt um digitale Inhalte und eignen sich hervorragend für die Zusammenarbeit, Wartung oder interaktives Lernen.
Moderne Geräte werden immer leichter, leistungsfähiger und bieten flexiblere Einsatzmöglichkeiten – sowohl in der Bildung als auch in der Arbeitswelt.
6. Immersive Technologie in Studium und Aus- und Weiterbildung

Immersive Technologien, wie Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) und Mixed Reality (MR), eröffnen völlig neue Möglichkeiten für die Bildung. Sie schaffen Lernumgebungen, in denen Studierende nicht nur passiv konsumieren, sondern aktiv und interaktiv in die Lerninhalte eintauchen können.
Immersion beschreibt das Eintauchen in eine digitale oder gemischte Realität.
Dabei wird die Wahrnehmung so angesprochen, dass Lernende sich wie „vor Ort“ fühlen – sei es in einem virtuellen Labor, in einer Simulation oder in einer Erweiterung der realen Welt mit digitalen Elementen.
Einsatzmöglichkeiten in der Lehre
Virtuelle Exkursionen: Mit VR können Lernende Orte besuchen, die sonst schwer zugänglich sind – wie historische Stätten, ferne Länder oder sogar das Innere des menschlichen Körpers.
Simulationen und Experimente: Physik- oder Chemieversuche können gefahrlos in VR durchgeführt werden, selbst wenn sie in der Realität teuer oder gefährlich wären.
Interaktive Modelle: Mit AR können 3D-Modelle von Maschinen, Molekülen oder anatomischen Strukturen direkt in den Klassenraum projiziert werden. Lernende können diese Modelle von allen Seiten betrachten und interaktiv erkunden.
Soft Skills und Kommunikation: VR-Szenarien ermöglichen Rollenspiele und Kommunikationstrainings, etwa in der Lehrerbildung oder im Sprachunterricht.
Fazit:
Wie schon beschrieben, fördern immersive Technologien fördern das selbstständige, entdeckende Lernen. Sie machen abstrakte Themen greifbar und regen Neugier sowie Motivation an. Komplexe Sachverhalte können durch Visualisierungen und Interaktion leichter verständlich werden. Die Integration immersiver Technologien in den Unterricht erfordert eine gute didaktische Planung. Außerdem sind die Kosten für Hardware und Software nicht zu unterschätzen. Lehrkräfte müssen sich zudem mit neuen Konzepten und Tools vertraut machen.
7. Immersion in Praxis und Ausbildung

In der Arbeitswelt wird Immersion ebenfalls zunehmend genutzt. In der Medizin können Chirurg*innen komplexe Operationen virtuell üben, bevor sie diese im OP durchführen. Im Ernstfall haben sie dann die Abläufe schon einmal „geübt“. In der Industrie erleichtert AR-Technologie die Wartung von Maschinen, indem Arbeitsschritte direkt ins Sichtfeld projiziert werden. Immersive Trainingsumgebungen verbessern Soft Skills, indem sie realitätsnahe Situationen simulieren – von Kundengesprächen bis zu Notfallübungen.
Trotz aller Chancen gibt es auch dort Herausforderungen. Immersive Technologien sind oft teuer und erfordern leistungsstarke Hardware sowie geeignete Software. Außerdem müssen sie didaktisch sinnvoll in Arbeitsprozesse integriert werden. Wenn Immersion nur als „technisches Gimmick“ eingesetzt wird, verpufft ihr Potenzial schnell. Auch gesundheitliche Aspekte wie „Cyber Sickness“ (Schwindel, Übelkeit) müssen berücksichtigt werden.
Merke: Eintauchen in die VR-Welt mit Verantwortung in der Praxis
Immersion in der Praxis eröffnet spannende neue Wege, um Lernen und Arbeiten praxisnäher, motivierender und interaktiver zu gestalten. Damit sie ihren vollen Mehrwert entfalten kann, braucht es nicht nur leistungsfähige Technik, sondern auch kluge Konzepte und ein Bewusstsein für die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer. Wenn diese Faktoren zusammenspielen, wird Immersion zum Schlüssel für eine neue Art des Erlebens, Lernens und Arbeitens.
8. Studien und Forschung zum Thema VR und AR / Aktueller Forschungsstand

Zum Thema VR und AR gibt es immer mehr Studien. Hier einmal ein paar eindrucksvolle Studien aus den letzten Jahren, die zeigen, dass VR durchaus sinnvoll in der Hochschullehre und der Ausbildung eingesetzt werden kann:
Studie 1:
Raffael Padilla Perez, Özgür Keleş Ph.D. (2025): Immersive Virtual Reality Environments for E mbodied Learning of Engineering Students. arXiv:2401.08714
Die Forschende entwickelten ein immersives VR-Framework zur Verbesserung des Ingenieurunterrichts mittels digitaler Laborsimulationen. In der VR-Umgebung konnten Studierende Maschinen und Materialien realitätsnah manipulieren. Das Forscherteam betonte die Bedeutung von “Embodied Learning” durch physisch erlebbare Interaktion. In einer Vergleichsstudie zeigten sich signifikant bessere Ergebnisse beim Verständnis und der langfristigen Wissensbehaltung. Im Ergebnis übertraf die VR-basierte Gruppe die Kontrollgruppe mit herkömmlichen Desktop-Simulationen deutlich. Die Forschende empfehlen daher den Einsatz solcher Umgebungen besonders in technischen Studiengängen.
Studie 2:
Elena Battipede, Antonella Giangualano, Paolo Boffi, Monica Chierici, Alessandro Calvi, Luca Cassenti, Roberto Cialini, Tristan Lieven Annemie Van Den Weghe, Loredana Addianto, Pier Luca Lenzi und Alberto Gallace (2024): Physics Playground: Insights from a Qualitative-Quantitative Study about VR-Based Leraning. arXiv:2412.12941
Die vorliegende untersuchte das Potenzial eines interaktiven VR‑Lernspiels zur Vermittlung physikalischer Konzepte. In einem Mixed‑Methods‑Ansatz wurde eine Gruppe von Lernenden, die mit dem immersiven VR‑System arbeiteten, mit einer Kontrollgruppe verglichen, die klassische Slideshow‑Inhalte erhielt. Beide Gruppen verbesserten ihr physikalisches Fachwissen und Selbstvertrauen signifikant, wobei die Slideshow‑Gruppe in den quantitativen Tests einen leichten Vorteil zeigte. Die kognitive Belastung wurde von beiden Gruppen als ähnlich empfunden, was auf eine ausgewogene didaktische Gestaltung der VR‑Umgebung hinweist. Die qualitativen Daten zeigten jedoch, dass die VR‑Lernenden ein höheres Maß an Motivation, Freude und Einbindung berichteten, was auf die immersive Lernumgebung und die Interaktivität mit dem Avatar “Emanon” zurückgeführt wurde. Insgesamt betonte die Studie, dass VR zwar keine besseren kognitiven Ergebnisse garantiert, aber eine bedeutende Rolle in der Gestaltung engagierender und nachhaltiger Lernerfahrungen spielen kann.
Studie 3:
Xiano Ping Lin, Bin Bin Li, Then Ning Yao, Zhi Yang and Mingshu Zhang: The impact of virtual reality on student engagement in the classroom-a critical review of the literature. Frontiers in Psychology, 15, Article 1360574
Das Team untersuchte in einem systematischen Review, wie Virtual Reality das kognitive, verhaltensorientierte und affektive Engagement von Schüler*innen beeinflusst, basierend auf 33 Studien aus dem Zeitraum 2014 bis 2023. Sie zeigten, dass VR-Lernumgebungen insbesondere für Lernende mit Förderbedarf signifikante Effekte auf Aufmerksamkeit, aktive Beteiligung und emotionale Bindung an den Unterricht erzielen können. Trotz dieser positiven Wirkungen betonen die Autor*innen systemische Herausforderungen wie mangelnde digitale Kompetenz bei Lehrkräften, fehlende technische Infrastruktur und erhöhte Anforderungen an die Medienbildung der Schüler*innen. Die kognitive Belastung wird als moderat bewertet, was nahelegt, dass VR didaktisch sinnvoll integriert werden kann ohne Überforderung. Abschließend sprechen sich die Forschenden dafür aus, dass Bildungspolitik und Schulsysteme intensivere Fortbildung und technischen Support bereitstellen müssen, um VR nachhaltig in Lehrpläne einzubetten. Insgesamt präsentiert dieses Paper VR als entscheidenden Hebel zur Steigerung des Schülerengagements, fordert aber gezielte Maßnahmen zur Unterstützung und Integration in Bildungskontexte.
Studie 4:
Hugo Ariel Santos Garduño, Martha Idalia Esparza Martínez and May Portuguez Castro: Impact of Virtual Reality on Student Motivation in a High School Science Course. Applied Sciences, 11(20), 9516
Das Team untersuchte den Einsatz von Virtual Reality im Chemieunterricht der Oberstufe, um abstrakte molekulare Prozesse immersiv erfahrbar zu machen und dadurch Lernmotivation zu steigern. In einer Studie mit 304 Schüler*innen ermöglichte eine VR‑Anwendung wie „Mel Chemistry“ interaktive und der jeweiligen Aufgabe angepassten Erkundungen von Molekülen, was besonders in Bezug auf Aufmerksamkeit (72 %), Relevanz (61 %), Vertrauen (64 %) und Zufriedenheit (71 %) positive Bewertungen erhielt. Die immersiven 3D‑Modelle der VR‑Lernumgebung boten eine gefahrlose Alternative zu traditionellen Laboren, die oft mit hohen Kosten, Risikofaktoren und logistischer Komplexität verbunden sind. Die Studie hob zugleich hervor, dass eine erfolgreiche Implementierung von VR technisches Know-how seitens Lehrkräfte und Lernende sowie geeignete institutionelle Rahmenbedingungen, inklusive Infrastrukturversorgung und finanzieller Unterstützung, voraussetzt. Insgesamt zeigte die Untersuchung, dass VR im naturwissenschaftlichen Unterricht ein signifikantes Potenzial besitzt, Motivation und Engagement zu fördern, allerdings nur dann, wenn immersive Technologien fachkundig eingesetzt und didaktisch eingebettet werden.
Studie 5:
Anna Carolina M. Queiroz, Géraldine Fauville, Fernanda Herrera, Maria Isabel da Silva Leme, Jeremy N. Bailenson (2022): Do Students Learn Better with Immersive Virtual Reality Videos Than Conventional Videos? A Comparison of Media Effekts with Middle School Girls. Technology, Mind, and Behavior, 3(3)
Das Team analysierte in der Studie,ob immersive Virtual-Reality-Videos (IVR) beim Lernen effektiver sind als herkömmliche 2D-Videos bei Schüler*innen der Mittelstufe. In zwei Experimenten mit insgesamt 192 Teilnehmerinnen zeigte sich, dass IVR die Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Handlungskontrolle (Agency) kurzfristig positiv beeinflussen kann. Während im ersten Experiment keine signifikanten Unterschiede im fachlichen Lernzuwachs gemessen wurden, zeigte das zweite, dass IVR die Fähigkeit zur Wissenskonstruktion förderte. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass immersive Medien insbesondere dann wirksam sind, wenn komplexe kognitive Prozesse wie kreatives Denken oder Problemlösen gefördert werden sollen. Allerdings relativierten sich die Vorteile langfristig, da nach fünf Wochen keine signifikanten Unterschiede mehr zwischen den Gruppen im Wissenserhalt festgestellt wurden. Insgesamt zeigte die Studie, dass IVR ein potenziell wirksames Lernmedium sein kann, jedoch nicht pauschal konventionelle Lernformen übertrifft und gezielt in pädagogische Konzepte eingebettet werden sollte.
Fazit:
Die aktuellen Studien zeigen, dass VR und AR zunehmend in Bildungseinrichtungen integriert werden und das Potenzial haben, das Lernen interaktiver und praxisnäher zu gestalten. Während die Technologie vielversprechende Möglichkeiten bietet, ist es wichtig, die Akzeptanzfaktoren zu verstehen und potenzielle Auswirkungen auf die Wahrnehmung und Interaktion der Lernenden zu berücksichtigen.
9. Kritische Schlussbetrachtung und Ausblick

Virtual Reality (VR) und Augmented Reality (AR) gehören zu den faszinierendsten Technologien unserer Zeit. Sie versprechen, Lernen, Arbeiten und Unterhaltung grundlegend zu verändern, indem sie immersive Erlebnisse schaffen. Doch bei aller Euphorie lohnt sich ein kritischer Blick auf Chancen und Herausforderungen – und ein realistischer Ausblick in die Zukunft.
Chancen: Mehr als nur Technikspielerei?
VR und AR ermöglichen Lern- und Arbeitsumgebungen, die bislang undenkbar waren. In der Bildung können komplexe Inhalte anschaulich und praxisnah vermittelt werden – etwa durch virtuelle Labore oder historische Exkursionen. In der Industrie unterstützen AR-Brillen Wartungs- und Montagearbeiten, während VR realitätsnahe Trainings für Notfälle ermöglicht. Auch in der Medizin eröffnen immersive Technologien neue Wege für Diagnostik, Therapie und Chirurgie.
Herausforderungen: Kosten, Akzeptanz und Gesundheit
Trotz dieser Chancen sind VR und AR keine Selbstläufer. Hochwertige Hardware ist teuer, und viele Bildungseinrichtungen oder Unternehmen können sich diese Investitionen nur schwer leisten. Auch die Akzeptanz ist nicht immer selbstverständlich: Für viele Nutzerinnen und Nutzer sind immersive Technologien noch ungewohnt, und es braucht Zeit, um ihre Potenziale sinnvoll einzusetzen.
Ein weiteres Problem sind gesundheitliche Aspekte: Längere Nutzung kann zu Schwindel oder Übelkeit führen („Cyber Sickness“). Bei AR besteht zudem die Gefahr, dass Nutzerinnen und Nutzer von digitalen Informationen überfordert werden, wenn diese nicht sorgfältig in die reale Umgebung integriert werden.
Neben technischen Herausforderungen werfen immersive Technologien auch ethische Fragen auf. VR und AR-Anwendungen sammeln große Mengen an Daten, etwa Bewegungsprofile oder Blickverhalten. Diese sensiblen Informationen müssen geschützt werden, um Missbrauch zu verhindern. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass virtuelle Welten echte Begegnungen und soziale Kontakte ersetzen oder einschränken, anstatt sie zu ergänzen.
Ausblick in die Zukunft: Integration und Weiterentwicklung
Trotz aller Herausforderungen ist klar: VR und AR werden weiter an Bedeutung gewinnen. Fortschritte in Prozessorleistung, Miniaturisierung und KI werden Geräte leichter, günstiger und leistungsfähiger machen. In der Bildung könnten immersive Technologien Standard werden, um anschauliches, entdeckendes Lernen zu fördern. In der Arbeitswelt werden sie Prozesse optimieren, Sicherheit erhöhen und Kreativität anregen.
Die entscheidende Frage wird dabei sein, wie wir VR und AR verantwortungsvoll und sinnvoll integrieren. Technik allein ist kein Garant für besseren Unterricht oder effizientere Arbeitsabläufe. Es braucht didaktisch durchdachte Konzepte, klare Zielsetzungen und die Bereitschaft, immersive Technologien als Werkzeug und nicht als Selbstzweck zu begreifen.
Fazit:
Virtual Reality und Augmented Reality bieten großes Potenzial, um Lernen, Arbeiten und Kommunikation neu zu gestalten. Doch sie sind kein Ersatz für bewährte Methoden, sondern eine Ergänzung, die mit Bedacht eingesetzt werden muss. Wenn technische, didaktische und ethische Aspekte berücksichtigt werden, können immersive Technologien ein echter Gewinn für die Zukunft sein.
